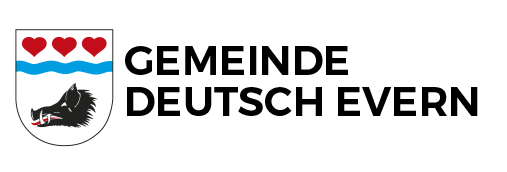Geschichte der Gemeinde Deutsch Evern
Vorgeschichte
Deutsch Evern, wurde zum ersten Mal urkundlich in einer Urkunde aus dem Jahr 1148 erwähnt, ausgestellt von Dietmar II, Bischof von Verden, Amtszeit von 1116-1148.
Archäologische Funde zeigen, dass die Besiedlung des Ortes schon sehr viel früher begonnen hat. Funde aus der Steinzeit, wie z.B. ein Flintdolch aus rotem Helgoländer Feuerstein, aber besonders die bronzezeitliche Hügelgräber auf dem Rakamp deuten auf eine frühe Besiedlung hin,
Zwischen 1908 und 1970 wurden 32 der ca. 50 Hügelgräber von Archäologen geöffnet, kartiert und die Funde dokumentiert. Ca. 2000 bis 800 Jahre vor Chr. wurden die Gräber errichtet,
Die Funde waren so bedeutend, dass die Wissenschaftler einen Abschnitt der Bronzezeit als „Stufe von Deutsch Evern“ bezeichneten. In einem Grabhügel fand man die „Dame von Deutsch Evern“ zusammen mit alten wertvollen Bronzeschmuck, der heute in einer eigenen Vitrine im Museum Lüneburg besichtigt werden kann..
Die vorrömische Eisenzeit, 800-100 Jahre v. Chr., wurde ebenfalls durch Urnenfunde in Deutsch Evern nachgewiesen.
- Alte Verflechtungen Deutsch Evern – Lüneburg
Der Name Deutsch Evern leitet sich von der Adelsfamilie von Everinge ab, die auf der Lüneburger Saline Anteile an Siedepfannen besaß und vermutlich im 12. Jh. Grundbesitz in Deutsch Evern erworben hatte.
Dokumente aus den 13. Jahrhundert liefern erste Nachweise der engen Beziehungen zwischen Lüneburg und Deutsch Evern, die bis heute andauern. 1366 schenkte der Lüneburger Bürger Albert Thode seiner Frau zur Hochzeit einen Hof in Deutsch Evern.
Bis ins 19. Jh. hatten u.a. Lüneburger Familien grundherrliche Rechte an den Bauernhöfen in Deutsch Evern und erhielten dafür jährliche Geld- und Naturalleistungen, die größtenteils erst in der 2. Hälfte des 19. Jh. abgelöst werden konnten. Um die Ablösungsbeträge finanzieren zu können, verkauften die Bauern in Deutsch Evern Teile ihrer Höfe an die Stiftung zum Großen Heiligen Geist in Lüneburg
Besonders eng war die Verflechtung mit Lüneburg über die St. Johanniskirche mit den dazugehörigen Friedhöfen, da Deutsch Evern bis 1987 keine eigene Kirchengemeinde und bis 1908 keinen eigenen Friedhof hatte.
Weiterführende Schulen in Lüneburg, wie das Johanneum, wurden nachweislich ab 1866 von Schülern aus Deutsch Evern besucht, natürlich gegen Bezahlung des entsprechenden Schulgeldes.
Den frühen Einfluss Lüneburgs auf Deutsch Evern dokumentiert auf eindrucksvolle Weise der Bau der alten und neuen Landwehr: Die alte Landwehr umschloss nur den Bereich westlich der Ilmenau. Durch den Bau der neuen Landwehr von 1479 – 1484 geriet Deutsch Evern vollkommen in den Machtbereich Lüneburgs, da Lüneburg den Bereich innerhalb der Landwehren als seinen Gerichtsbezirk ansah. 1576 wurde der Gerichtsbezirk östlich der Stadt durch einen Vertrag mit dem Herzog wieder auf ungefähr die heutige Stadtgrenze beschränkt. Die neue Landwehr verfiel teilweise. Noch heute sieht man im Dieksbecktal an der Grenze zu Hohenbostel Reste der ursprünglich fünf angelegten Staudämme, mit denen man den Dieksbeck aufstaute, um den Verkehr u.a. aus Braunschweig nach Lüneburg zu regulieren und kontrollieren. Die zweirädrigen Fuhrwerke konnten über einen Durchlass das Tal des Dieksbeck durchqueren, während die vierrädrigen Fuhrwerke das Dieksbecktal östlich umfahren mussten.
- Deutsch Evern als Manöverschauplatz
Große, kahle, mit Heide bewachsene Flächen erstreckten sich im 18. Jh. im Süden und Osten von Deutsch Evern. Nadelwald gab es noch nicht. Laubbäume standen nur an den Bachläufen und im Ortszentrum. Diese Gegebenheiten und die Nähe zur Stadt Lüneburg boten dem Militär ideale Bedingungen für große Manöver, von denen zwei besonders erwähnenswert sind.
Vom 11. – 20. Juni 1782 hielt die Kurhannoversche Armee ein Manöver in Deutsch Evern ab. 4340 Soldaten mit ihren 1222 Pferden hatten ihr Lager südlich der Melbecker Straße Richtung Blocksberg aufgeschlagen. Geübt wurde Richtung Wendisch Evern, Hohenbostel und Bienenbüttel.
Vom 24. – 09.10.1843 war das 10. Deutsche Bundeskorps zum Manöver in Deutsch Evern stationiert. Für die 25.415 Soldaten wurden 2.500 Zelte auf dem Wandelfeld aufgestellt. Allein die Verpflegung war eine logistische Herausforderung; so lieferte eine Schlachterei aus Hamburg täglich das Fleisch von 30 – 35 Ochsen, aber auch ca. 39.000 Liter Branntwein wurde genossen. Den Abschluss des Manövers bildete in Anwesenheit des preußischen Königs und vieler Fürsten eine große Parade in Hagen. Aufgrund des schlechten Wetters und der mangelhaften Hygiene verstarben neun Soldaten während des Manövers.
Gemeinheitsteilung und Verkoppelung verändern Deutsch Evern
Das althergebrachte System der Landwirtschaft stieß nach der napoleonischen Zeit an seine Grenzen. Durch Napoleon waren einerseits neue, freiheitliche Ideen mit mehr Bürgerrechten ins Land gekommen. Andererseits reichten die Erträge der zersplitterten Landwirtschaft nicht mehr aus, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren. Um eine effektivere, von mehr Eigenverantwortung geprägte Landwirtschaft zu ermöglichen, wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Königreich Hannover Agrarreformen durchgeführt. Eine davon war die Gemeinheitsteilung und Verkoppelung. D.h. die bisher gemeinschaftlich genutzten Brach- und Heideflächen, Gemeinheiten oder Allmende genannt, sowie die bisher von den Bauern einzeln bewirtschafteten Flächen wurden zusammengefasst, bewertet und nach einem Verteilerschlüssel an die beteiligten Bauern verteilt. Die Zuteilung auf die einzelnen Höfe erfolgte nach Großvieheinheiten. Gleichzeitig wurde ein neues Wegenetz angelegt und in einem Rezess (Auseinandersetzungsvertrag), die Rechte und Pflichten der Beteiligten, z.B. Wegerechte, niedergeschrieben.
Elf Hofbesitzer und die Schule waren beteiligt:
Die alten Zehnt- und grundherrlichen Rechte blieben bestehen und gingen auf die neu zugeteilten Flächen über.
Eine zweite Gemeinheitsteilung und Verkoppelung wurde 1842 für den Tiergarten abgeschlossen. Für Deutsch Evern ging es um wichtige Weideberechtigungen im Tiergarten, der aufgrund des Laubbaumbestandes für die Schweinemast wichtig war. Zudem war der sogenannte Kirch- und Totenweg durch den Tiergarten, der heute noch als Rad- und Fußweg genutzt wird, wichtig für die Verbindung nach Lüneburg. Nach mehrjährigen Verhandlungen zwischen der Stadt Lüneburg als Vertreter der Stiftung zum Großen Heiligen Geist und den Nachbargemeinden Wendisch Evern und Hagen konnte das Verfahren abgeschlossen werden.
Bau der Eisenbahn
1847 wurde die durch Deutsch Evern führende eingleisige Bahnstrecke Celle – Harburg in Betrieb genommen. Das zweite Gleis wurde in den folgenden Jahrzehnten abschnittsweise gebaut.
Die Bahn zerschnitt Deutsch Evern in der Ortsmitte. Besonders betroffen war der Hof auf der heutigen Dorfstraße 1, der in der Mitte durch die Bahn geteilt wurde.
Die Bahn bot viele Arbeitsplätze, so dass zahlreiche Neubürger nach Deutsch Evern kamen.
1882 bekam Deutsch Evern eine eigene Haltestelle. Gemeinsam mit Melbeck wurde eine Fußgängerbrücke über die Ilmenau gebaut, damit auch die Melbecker Bürger die Bahn nutzen konnten.
1898 wurde der erste Bahnhof in Betrieb genommen. 1905 war auch Güterverkehr möglich. Die für den Güterschuppen und den Bau der Ladegleise benötigten Grundstücke trat die Gemeinde kostenlos an die Bahn ab.
1976 wurde die Bahnhaltestelle in Deutsch Evern im Zuge des Streckenausbaus geschlossen.
Schulneubau an der Dorfstraße.
Mitte des 19. Jh reichte das recht baufällige Schulgebäude aus dem Jahre 1686 nicht mehr aus, um die wachsenden Schülerzahlen aufzunehmen. 1859/1860 wurde an der Dorfstraße eine neue Schule erbaut. Da der Lehrer gleichzeitig auch Landwirt war, wurde ein Bauernhaus mit Schulstube errichtet. Der Schulneubau wurde von den Grundeigentümern finanziert. Mit steigenden Schülerzahlen wurden mehrere Erweiterungen notwendig. Die Gemeinde und Schulgemeinde waren getrennte Institutionen. Die Schulaufsicht wurde bis zum Ende des ersten Weltkriegs durch die Kirche ausgeübt.
1920 musste eine zweite Lehrerstelle eingerichtet werden, weil die Schülerzahl auf über 90 gestiegen war.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde eine ehemalige Arbeitsdienstbaracke neben der Schule aufgebaut und als weitere Schulklasse genutzt. Die Baracke wurde 1957 durch einen Schulneubau mit drei Klassenräumen ersetzt, in denen die Schuljahre 1-2, 3-5 und 6-8 unterrichtet wurden.
Nicolaus Harms wird zum Gemeindevorsteher gewählt.
1872 begann mit der Wahl von Nicolaus Harms zum Gemeindevorsteher die Protokollierung der Sitzungen der Gemeindeversammlungen. Die Protokolle, die bis auf die Zeit des Nationalsozialismus noch vollständig vorhanden sind, geben einen guten Überblick über die Entwicklung des Ortes.
Stimmberechtigt in der Gemeindeversammlung waren alle Bürger, die im Jahr mehr als 5 Mark Gemeindesteuern zahlten. Je mehr Steuern jemand zahlte, umso mehr Stimmen hatte er. Auch auswärtige Steuerzahler mit Grundbesitz in Deutsch Evern waren stimmberechtigt.
1900, als Georg Soltwedel zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hatte die Bahn als größter Steuerzahler mit 50 die meisten Stimmen, während ein normaler Hausbesitzer nur auf 1-2 Stimmen kam.
Bau der Ilmenaubrücke nach Melbeck.
In den 1890er Jahren wurde die Straßen im Dorf und die Straße nach Wendisch Evern mit Kopfsteinpflaster befestigt. 1900 begannen die Gemeinden Melbeck und Deutsch Evern mit dem Bau einer auch von Fuhrwerken nutzbaren Ilmenaubrücke. Die Fertigstellung der gepflasterten Brückenzufahrten nahm noch mehrere Jahre in Anspruch. Weitere Infrastrukturmaßnahmen vor dem 1. Weltkrieg waren 1908 die Einrichtung des Friedhofes auf der ehemaligen Schulkoppel an der Melbecker Straße, 1910 begann der Aufbau der Stromversorgung.
Durch die Einrichtung der Bahnhaltestelle, den Bau der Brücke nach Melbeck und die Eröffnung der Güterannahmestelle am Bahnhof kam es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in Deutsch Evern. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich von ca. 150 Einwohnern Anfang des 19. Jh. auf ca. 300 zum Ende des Jahrhunderts. Die Zahl der Häuser stieg im gleichen Zeitraum von 12 auf 45.
1891 gründete Georg Soltwedel die Erdbeer-Plantage. Erste Handwerksbetriebe siedelten sich an: Die Tischlerei Michaelis an der Triftstraße, die Zimmerei Hesebeck am Schulweg, Die Schusterei Meyer an der Timelostraße, noch heute in Familienbesitz, und die Schlachterei Meyer am Hengstberg. Später kamen noch die Stellmacherei Heitsch am Schulweg und die Schmiedewerkstatt Dankers an der Dorfstraße hinzu. Das älteste Gasthaus im Ort war das Gasthaus Wulf an der Dorfstraße, heute Ärztehaus und Apotheke. Um 1895 errichtete der Gastwirt Rorig das Gasthaus „Dörpschenk“ An der Worth. 1910 wurde das Gasthaus „Niedersachsen“ erbaut.
-
- Gründung der Freiwilligen Feuerwehr
- 1902 beschloss die Gemeindeversammlung, eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Im Verlauf der Versammlung traten 37 Männer in die neugegründete Wehr ein. Erster „Hauptmann“ wurde Vollrad Harms. Die notwendige Ausrüstung wurde auf Gemeindekosten beschafft.
Bald nach Gründung der Feuerwehr wurde das erste „Spritzenhaus“ wurde an der Dorfstraße/ Ecke Moorfeld errichtet. 1959 erfolgte ein Neubau neben der Schule, der 1995 durch das neue Feuerwehrgerätehaus an der Tiergartenstraße ersetzt wurde.
1914 –1918 Erster Weltkrieg
Der erste Weltkrieg war auch für Deutsch Evern eine Zeit der Not und Trauer. Auf den Schlachtfeldern verloren zwölf Männer aus Deutsch Evern ihr Leben. Bald nach Kriegsbeginn kamen Flüchtlinge aus Ostpreußen nach Deutsch Evern und mussten versorgt werden. Immer wieder kann es zu Versorgungsengpässen. Wucherpreise für Lebensmittel wurde angeprangert. Der Versailler Vertrag von 1919 wurde von der Bevölkerung nicht akzeptiert.
In Gedenken an die Opfer des Krieges wurde 1925 ein Ehrenmal auf dem Friedhof errichtet.
- Die Zeit zwischen den Weltkriegen, Inflation und Geldnot.
Schon während des Weltkriegs zeichnete sich die beginnende Inflation ab. Sie lässt sich an den Zahlen der Gemeindeausgaben von 1916 bis 1923 gut ablesen:
1916 4955 Mark
1917 5591 Mark
1918 6588 Mark
1919 16317 Mark
1920 16750 Mark (geplant)
1921 27320 Mark (geplant)
1923 45980 Mark (geplant)
Die Währungsreform vom 15. November 1923 brachte ein Ende der Inflation. Viele Einwohner des Dorfes waren aber weiterhin auf Unterstützung durch die Gemeinde angewiesen.
Nur nach und nach wurden neue Häuser gebaut. Die ersten entstanden auf dem Petersberg, dem Fuchsberg und an der Melbecker Straße. 1940 hatte Deutsch Evern ca. 730 Einwohner.
Politisch gab es nach dem ersten Weltkrieg zunächst nur geringfügige Veränderungen. Anstelle der Gemeindeversammlung wurde ein Gemeindeausschuss eingesetzt. Er bestand aus 4 Hofbesitzern, 4 Abbauern (Kleinbauern) und 4 Arbeiter. 1919 fanden die ersten Wahlen zum Gemeindeausschuss statt.
Bei der Wahl zur Gemeindeversammlung im März 1933 wurde erstmals nach Listen gewählt. Die NSDAP errang 3 der 8 Sitze. Kurz darauf wurde der Gemeindevorsteher Paul Gerkens als Lehrer nach Bütlingen versetzt und musste sein Amt aufgeben. Im September 1933 trat ein neuer Gemeindeausschuss zusammen, in dem die NSDAP die Mehrheit hatte. Über die Folgezeit sind kaum Archivunterlagen vorhanden.
- Der 2. Weltkrieg
Kriegshandlungen hat es in Deutsch Evern kaum gegeben. Am 18. April 1945 besetzten die Engländer Deutsch Evern. Das in der Nähe der Melbecker Brücke stehende Haus von Gauleiter Telschow wurde zerstört. Zwei weitere Gebäude im Ort wurden beschädigt.
Am 04.05.1945 endete mit dem Waffenstillstand für den norddeutschen Raum, unterzeichnet auf dem benachbarten Timeloberg, der 2. Weltkrieg in unserer Region. Es folgte die Besatzungszeit durch die Engländer. Die offizielle Besatzungszeit endete mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949. 1958 verließen die englischen Soldaten Lüneburg und damit auch den Standortübungsplatz Deutsch Evern/Wendisch Evern.
Der 2. Weltkrieg forderte auch in Deutsch Evern viele Opfer. Auf den Gedenksteinen am Ehrenmal sind die Namen von 52 Kriegstoten eingraviert. Darunter auch Angehörige von Flüchtlingsfamilien, die ab 1945 in Deutsch Evern eine neue Heimat gefunden hatten.
Nach dem 2. Weltkrieg
Die bis heute andauernde Friedenszeit brachte für Deutsch Evern einen großen Aufschwung und veränderte den Ort hin zu einer modernen, lebendigen Gemeinde.
Die Auswirkungen des Krieges waren aber noch viele Jahrzehnte in Deutsch Evern spürbar. Rund 500 Flüchtlinge kamen nach Deutsch Evern. Wohnraum war mehr als knapp und die Versorgung der Bevölkerung ein großes Problem.
1946 trat ein neuer Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung zusammen. Erste kleine Wohnbauprojekte wurden in Angriff genommen.
Ab 1955 wurde eine Neubausiedlung auf dem Rakamp errichtet. Etwas später begann die Niedersächsische Heimstätte mit den Bau der ersten Siedlung am Eichkamp. Hier wurden bevorzugt Häuser für Flüchtlingsfamilien errichtet.
Nach und nach erwachte auch das Vereinsleben wieder. 1947 wurde auf dem Wandelfeld der in Eigenleistung angelegte neue Sportplatzes eingeweiht.
1954 wurde der Schützenverein neugegründet. 1955 errichtete der Verein einen Schießstand auf dem Grundstück von Gastwirt Bölck.
Weil die Bevölkerung stetig wuchs musste die Infrastruktur nach und nach erweitert werden.
Zu erwähnen sind hier besonders:
1975 Eröffnung Sport- und Jugendzentrums
1982 Neubau Pfarrhaus mit Konfirmandensaal
1988 Eröffnung Kindergarten Moorfeld
1988 Unterzeichnung der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Luneray
1989 Einweihung Martinuskirche
1991 Schulerweiterung und Bau der Aula
1994 Eröffnung Kindergarten Dorfstraße
1994 1. Ratssitzung in neuen Gemeindebüro
Heute ist Deutsch Evern eine aktive Gemeinde mit einer hohen Wohnqualität.
Wer Näheres zur Geschichte Deutsch Everns wissen möchte, dem empfehle ich das von mir verfasste und herausgegebene Buch „1148 -1998 Aus 850 Jahren Deutsch Evern Geschichte“. Das Buch ist für 20€ im Gemeindebüro erhältlich.
Jürgen Stehr
Ortsarchivar.